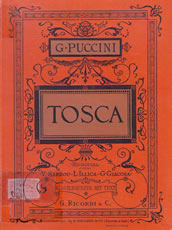|
|
Hintergrund Puccini – ein MissverständnisZum 100. Todestag des unter Kitschverdacht stehenden ModernistenVon Dieter David ScholzEs gibt wohl keinen anderen Komponisten, dessen Bewertung und Wertschätzung sich so wandelte wie die von Giacomo Puccini. Jahrzehntelang wurde seiner Musik bescheinigt, sie sei sentimental, wo nicht gar kitschig, und sie wurde als Vorwegnahme in die Nähe der Filmmusik von Hollywood gerückt. Selbst der Pianist Alfred Brendel soll auf die Frage nach dem größten Unglück geantwortet haben: „Puccini oder Lehár hören zu müssen.“ In seiner neusten Publikation ergreift Arnold Jacobshagen vehement Partei für Giacomo Puccini und weist darauf hin: „Zweifellos zählt Puccini zu den umsatzstärksten und wertbeständigsten Klassikern des internationalen Kulturbetriebs. La Bohème, Tosca, Madama Butterfly und Turandot gehören zum Kanon der abendländischen Kulturgeschichte.“ Puccini sei „neben William Shakespeare, Giuseppe Verdi und Henrik Ibsen der meistgespielte Tragödienautor des Welttheaters. Dieser Befund unterliegt keinen kurzfristigen Moden und konjunkturellen oder regionalen Schwankungen, sondern ist bereits seit mehr als einem Jahrhundert offenkundig und stabil.“ Die Gründe dafür bekräftigt Jacobshagen in seinem weit ausholenden Buch mit Analysen der musikalischen Dramaturgie sowie einer präzisen Werk- und Zeitdarstellung: Puccini habe „für die beiden Zentralthemen aller Tragödien – Liebe und Tod — unverwechselbare, ergreifende und überwältigende musikalische Gestaltungen“ erfunden. Puccini „Tosca“, Klavierauszug mit Text, Ricordi 1901 Puccinis Leben reichte weit ins 20. Jahrhundert, auch wenn man ihn eher in der Nähe des fast fünfzig Jahre älteren Verdi verortet, als an der Schwelle zur Moderne. Ein Irrtum, wie Jacobshagen klarstellt. Puccini war „ein Perfektionist singulären Ranges. Er schuf eine Reihe von Werken für die Opernbühne, die sich neben ihren offenkundigen dramaturgischen, melodischen, harmonischen und instrumentationstechnischen Qualitäten vor allem durch die äußerste Präzision sämtlicher musikalischer Strukturen und Details bei konsequentem Verzicht auf Randständiges und Ausuferndes, auf Leerlauf und Redundanz auszeichnen. Puccini war ein Meister des Zuspitzens wie des Maßhaltens – Eigenschaften, die sich übrigens nicht nur in seinen Werken, sondern auch in seiner Persönlichkeit zeigen.“ Puccinis Werk ist schmal: Zwölf Opern hat er komponiert, darunter eine unvollendete („Turandot“), und vier Einakter. Interessiert und distanziert zugleich verfolgte Puccini, wie die Zeitgenossen Schönberg, Webern und Berg aus dem klassischen System ausbrachen. Er selbst blieb der Tonalität jedoch im Wesentlichen treu. Es lässt sich nicht abstreiten: Puccinis Musik trifft ins Herz, aber es lohnt sich, diese Musik zu reflektieren, um zu erkennen, wie raffiniert das vermeintlich Seichte, das vermeintlich Konventionelle bei ihm ist. Die Forderung, den Schöpfer vom Werk zu trennen, um die Kunst zu bewahren, sollte der Künstler eines Tages nicht mehr den Anforderungen des Zeitgeistes gerecht werden, ist im Fall von Puccini fraglich. Puccini wollte nicht hinter seinem Werk verschwinden, zu sehr liebte er es, die Möglichkeiten des aufkommenden massenmedialen Zeitalters zu nutzen. Jacobshagens Buch macht das deutlich. Wohl wegen mangelnder Bezahlung ließ eine Claque „Madama Butterfly“ bei der Uraufführung an der Mailänder Scala durchfallen. „Es ist meine beste Oper, ihr Schweine“, soll Puccini aus seiner Loge gebrüllt haben. Aber selbst seine vielleicht modernste, wenn auch unvollendete Oper „Turandot“, die er mit Mut zur Disharmonie geschrieben hatte, bleibt genau dort, wo sie sich vorwagt, seltsam disparat – vergleicht man die Passagen mit der Radikalität von Richard Strauss’ immerhin schon 1909 uraufgeführter „Elektra“ oder gar mit dem schroff atonalen „Wozzeck“, an dem Alban Berg zeitgleich arbeitet. Dagegen stellte Puccini mit „Nessun Dorma“ den ästhetischen Regress zum Progress. Allerdings ist es keine Schande, von dieser Arie ergriffen zu sein. Puccini hat einmal Einblick in seine Arbeitsweise gewährt, nämlich in seinem „Trittico“, das Jacobshagen eine „retrospektive Zeitreise von der Gegenwart zurück bis ins hohe Mittelalter“ nennt. Nach Verdis „Falstaff“ legte Puccini mit „Gianni Schicchi“ eine meisterhafte Komödie vor und bewies, dass die oft totgesagte italienische Opera buffa noch erstaunliche Lebenskraft hat. Dieser humorvolle Höhepunkt von „Il Trittico“ erzählt eine Posse um einen Erbschaftsstreit. Lauretta und Rinuccio wollen heiraten, aber dies geht nur, wenn sie ein Vermögen erbt. Um ihren Vater zu manipulieren, singt sie völlig unvermittelt in diesem Commedia-dell’arte-Durcheinander die herzzerreißende Arie „O mio babbino caro“, in der sie droht, vom Ponte Vecchio zu springen, falls der Vater sich nicht für sie einsetze. Löst man diese Arietta mit ihrer lyrischen Melodie aus dem Kontext, liegt der Kitschverdacht nahe, bettet man sie hingegen richtig ein, ist nicht zu übersehen, dass der Komponist diese Musik ironisierte. Hier lässt sich beobachten, wie Puccini arbeitete, wenn er berühren und bewegen wollte, was ihm das Wichtigste war, wie er einmal in einem Brief bekannte. Nicht nur bei Laurettas Vater wirkt das süße Gift des Wohlklangs, sondern natürlich auch beim Publikum. Bemerkenswert ist jedoch, dass diese Musik, selbst wenn man von der Manipulationsabsicht weiß, trotzdem wirkt, ja, es macht sogar noch mehr Freude, sehenden Auges dem Sirenengesang auf den Leim zu gehen. Es ist der Gesang eines Trotzdem. „In gewisser Weise“, betont Jacobshagen, „präsentiert sich das gesamte Werk als eine einzige gewaltige Ensembleszene der fünfzehn am Stück beteiligten Figuren, von denen alle nahezu ununterbrochen auf der Bühne anwesend bleiben, wie René Leibowitz hervorgehoben hat: ‚Gleichwohl erzeugt diese ständige Präsenz der Figuren keinerlei Immobilität oder Statik, denn es ist die Musik, der es in überwältigender Weise gelingt, die Bewegung und Aktion des Dramas zu konstituieren.‘ Hierin unterscheidet sich das Stück fundamental von den üblichen Gepflogenheiten der Opera buffa, für die der rasche Wechsel von Soloszenen, Duetten und größeren Ensembles konstitutiv ist und in denen gewöhnlich nur in den Finalnummern das gesamte Bühnenpersonal vereinigt ist. Dieser ständige szenische Wechsel fehlt in Gianni Schicchi, und selbst Lorettas berühmte Kurzarie ‚O mio babbino caro‘ steht nicht für sich isoliert, sondern erweist sich als Bestandteil der übergeordneten Ensemblestrukturen. Puccini kompensiert die szenische Uniformität vor allem durch extreme Besetzungsunterschiede und äußerste Flexibilität in der Orchesterbehandlung. Seine motivisch-thematische Arbeit beruht überwiegend auf kurzen melodischen Zellen, die einem kontinuierlichen Repetitions- und Variationsprozess unterworfen werden… Präsentiert sich Puccini in der virtuosen Durchgestaltung dieser motivisch-thematischen Arbeit gleichsam als Neoklassizist, so beindruckt das suggestive Insistieren auf solchen Elementarstrukturen im Kontext der musikalischen Moderne durch ein erhebliches Innovationspotenzial.“ Puccini, so zeigt Jacobshagen, erweist sich auch und gerade „in seiner einzigen komischen Oper als ein Seismograph der musikalischen Moderne“. Arnold Jacobshagen: „Giacomo Puccini und seine Zeit“ Die Trotzdem-Haltung ist allen Opern Puccinis eigen: zum einen, damit das Denken nicht übergangen wird, denn es verhindert nicht, sondern intensiviert die Gefühle durch Bewusstwerdung; zum anderen, weil Puccini selbst diesen Umweg macht, in „La Bohème“, „Tosca“, „La Fanciulla del West“, „Madama Butterfly“ oder „Manon Lescaut“. Indem bitterste Wirklichkeiten nicht mit bitterer Musik dupliziert werden, sondern im Wohllaut daherkommen, manifestiert sich der Wunsch nach einer Gegenwelt als einem Trotzdem. Ganz anders dagegen Kitsch. Dieser evoziert falsche Gefühle. Damit hat Puccini nichts zu tun. Trotzdem zu lieben (und zu singen), leidenschaftlich und überschwänglich, davon erzählt Puccini mit seiner Musik. Verismus bedeutet in diesem Sinne, die wahre Radikalität des Gefühls zu erkennen. Puccinis Werke fordern vom Publikum einen Protest gegen eine Wirklichkeit, die die Wahrhaftigkeit verunmöglichen will. Puccini zu lieben bedeutet, sich zu diesem Trotzdem zu bekennen. Am Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert hatte Giacomo Puccini von Giuseppe Verdi endgültig den Rang des berühmtesten lebenden Komponisten italienischer Opern übernommen. Schon 1898 schrieb George Bernard Shaw nach dem Besuch von „Manon Lescaut“ in London: „Puccini scheint für mich mehr als jeder andere seiner Rivalen der Erbe Verdis zu sein.“ Mit Puccini erlebte die Oper einen Paradigmenwechsel, was schon am Beispiel der Geschlechterrollen und Operntitel sichtbar wird. Viele seiner Titelheldinnen sind Frauen, die liebend leiden oder leidend lieben, die sich selbst opfern oder geopfert werden. Puccini nennt in den Titeln seiner Opern acht Frauen, aber nur zwei Männer beim Namen. Bei den beiden Giganten unter den Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts, Giuseppe Verdi und Richard Wagner, dominieren noch Männer in den Werktiteln. Insgesamt blieb Puccini seinen Idealen zu Musik und Theater treu. Selbst als die Harmonien seiner Opern komplizierter wurden, entfernte er sich nur geringfügig von der chromatischen Vielschichtigkeit der Romantik. Und doch fand sein Werk das Lob zahlreicher Kollegen: Strawinsky, Ravel und Schönberg – für den Puccinis Werk dasjenige Verdis übertraf – brachten ihre Bewunderung zum Ausdruck. Ein deutscher Journalist schrieb nach der Premiere von „Turandot“: „Puccini hat hier sicherlich die raffinierteste Musik seines Lebenswerkes geschrieben – sie reicht von Strauss zu Strawinsky über Mahler und Schönberg. Er kannte alles, wusste alles und konnte ungeheuer viel, besonders in der ,Turandot‘.“ Zugleich wurde Puccini zu Lebzeiten von seinen vermeintlich fortschrittlicheren Zeitgenossen Casella, Pizzetti und Malipiero als Konservativer geschmäht, der sentimentale Werke schrieb, die dem Bürgertum gefallen sollten. Bis in die jüngste Vergangenheit schlossen sich diesem Urteil Komponisten und Musikwissenschaftler verschiedenster Couleur an. Puccini respektierte seine italienischen Vorfahren und wollte natürlich auch dem Publikum gefallen (wie auch nicht). Aber er war auch fasziniert von den bahnbrechenden europaweiten Entwicklungen in der Musikwelt und Technik. Das bemerkenswerte Fotomaterial in Jacobshagens Buch spricht für sich. Puccini wird in der Regel als Vertreter des Endes einer Tradition gesehen, aber er hat den Speer weit in die Zukunft geschleudert. Anspielungen auf seinen Stil lassen sich in Werken von Janáček, Korngold, Orff und Berio hören. Letzterer schrieb 2001 eine eigene Schlussergänzung von „Turandot“. Unzählige Komponisten von Musiktheater, Musical und Filmmusik, von Rodgers und Hammerstein bis John Williams haben sich von Puccini hörbar beeinflussen lassen, ebenso der Jazzmusiker Al Jolson oder der Musicalkomponist Andrew Lloyd Webber, um nur wenige Beispiele zu nennen. „Ein guter Musiker muss alles können, aber nicht alles geben“, hat Puccini einmal treffend formuliert. Dass ihn die technologische Präzision seiner Partituren zu einem der ersten Repräsentanten des modernen europäischen Musiktheaters macht, haben nach vielen Jahren der Ignoranz zunehmend auch die Interpreten, Regisseure und Musiker seiner Werke erkannt. „Angesichts dieser Gegebenheiten sollte heute eigentlich Niemand mehr leichtfertig den Fehler begehen, Puccini als Komponisten zu unterschätzen. Zwar war es in gewissen High-Brow-Milieus lange Zeit üblich, Puccini mit Missachtung zu begegnen. Kurt Tucholskys Diktum, Puccini sei der ‚Verdi des kleinen Mannes‘, spiegelt besonders die Ansichten jener Kreise wider, die auch in Verdi bloß den reißerischen ‚Leierkastenmann‘ sehen wollten... Noch immer sind zahllose, darunter sehr namhafte Autoritäten aus allen Bereichen des Musik- und Wissenschaftsbetriebs recht anfällig für solche Fehleinschätzungen.“ Jacobshagen ist nichts hinzuzufügen. Dieter David Scholz Buchtipp
|
|
|
|
© by Oper &
Tanz 2000 ff. |